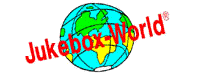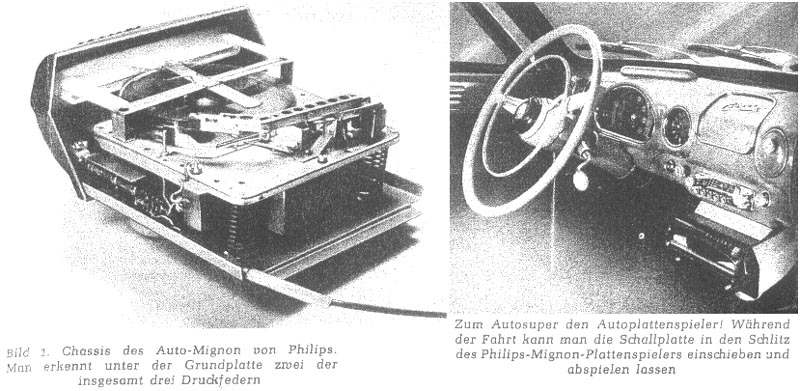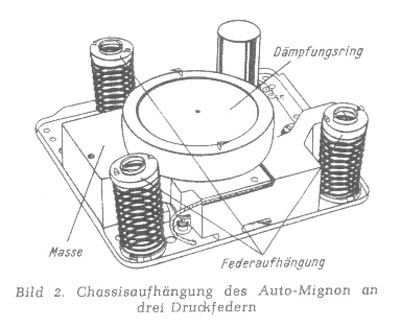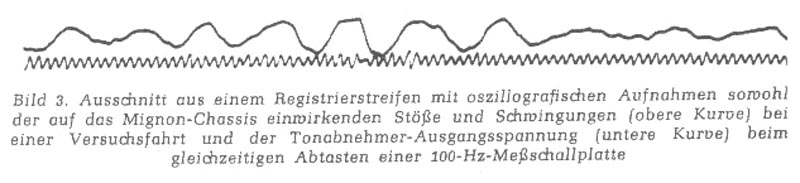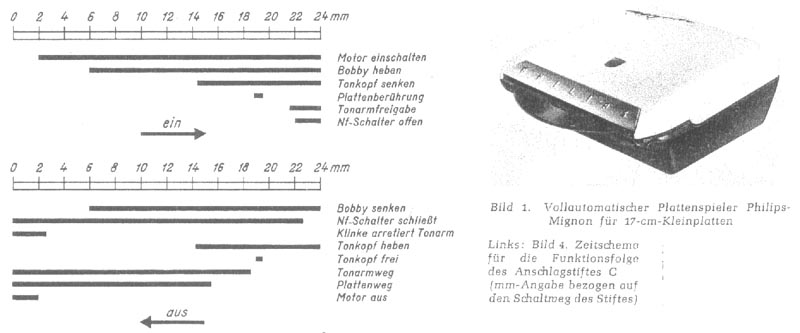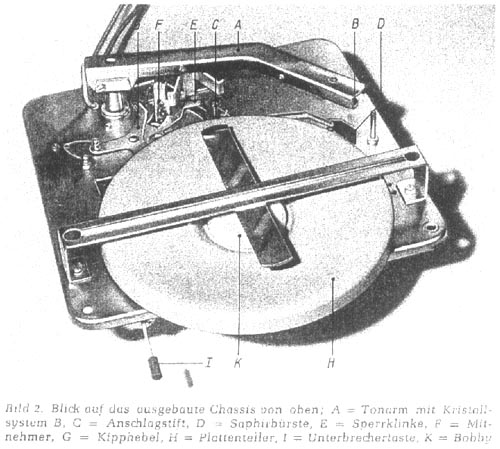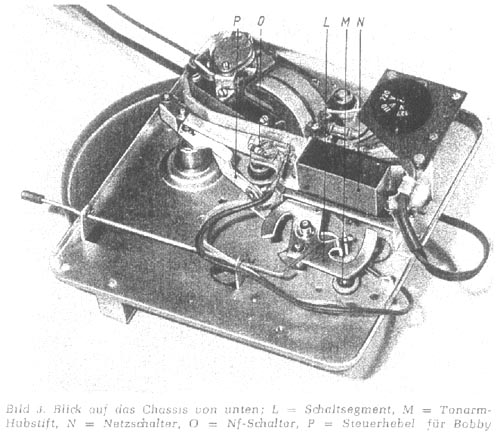|
Quelle: FUNKSCHAU ???? /
Heft ??, Seite 210 – 211
Das Abspielen von Schallplatten im fahrenden Kraftwagen war bisher eine
unsichere Angelegenheit, denn es gelang kaum, einen Plattenspieler
herkömmlicher Art so sicher aufzuhängen, daß er allen Stößen und
Schwingungen entgeht. Das geringe Auflagegewicht des Tonabnehmers (~ 10
g) und die geringe Rillentiefe (~ 40 µ) — insgesamt also die kleine
Haftfähigkeit des Tonarms in der Rille — sind dem Abspielen von
Mikrorillenplatten bei Erschütterungen unzuträglich.
Es gibt amerikanische Konstruktionen für Autoplattenspieler mit 16
2/3-Schallplatten, jedoch ist hier der Aufwand für Dämpfung usw. recht
hoch. Im Gegensatz dazu ist der neue, von Philips entwickelte
Auto-Plattenspieler „Auto-Mignon" aufwandsmäßig klein gehalten, obwohl
er alle äußeren Bewegungseinflüsse ausgleicht wie Schwingungen, Stöße
sowie Fliehkräfte durch Kurvenfahren und Schräglage.
Im Prinzip hat man hier die Mechanik vom Mignon-Gerät für das
halbautomatische Abspielen von 17-cm-Kleinplatten übernommen (FUNKSCHAU
1956, Heft 21, Seite 883). Man schiebt die Platte mit herausgenommenen
Mittellocheinsatz durch den Schlitz, womit alle Bewegungsvorgänge wie
Einschalten des Motors, Anheben und Aufsetzen des Tonarms ausgelöst
werden. Damit ist die im Kraftwagen sehr wichtige Forderung nach
einfachster Bedienung erfüllt. Bild 1 zeigt das Innere des Gerätes.
Die auf die Schallplatte und den Tonarm einwirkenden dynamischen Kräfte
werden von einem mechanischen Schwingkreis aufgefangen, dessen
Eigenresonanz so niedrig liegt, daß das Plattenspielerchassis
unempfindlich gegenüber den von außen einwirkenden mechanischen
Einflüssen bleibt. Es ist freischwingend auf drei Druckfedern aufgehängt
(Bild 2), von denen zwei auch in Bild 1 zu erkennen sind. Damit nun die
Drehzahl des Plattentellers beim Ausfahren enger Kurven durch die dann
auftretende Fliehkraft nicht beeinträchtigt wird, liegen zwischen dem
6-V-Motor und dem eigentlichen Plattenteller zwei Zwischenräder; nach
Werksangaben bleiben die Gleichlaufschwankungen auf diese Weise unter 9
Promille. - Die Spannungsschwankungen der Wagenbatterie werden zwischen
4,5 und 7,8 V selbsttätig durch einen Fliehkraftregler ausgeglichen und
haben daher einen vernachlässigbar kleinen Einfluß auf die Drehzahl (0,5
%).
Das Auflagegewicht des mit einem Gegengewicht statisch ausgewuchteten
Tonarms beträgt 10 g; sein Kristallsystem hat einen Frequenzumfang von
30 bis 15 000 Hz und einen Abschlußwiderstand von 470 kOhm. Die
Ausgangsspannung erreicht ~ 300 mV eff.
Ein Problem besonderer Art ist der Anschluß des „Auto-Mignons" an den
Autoempfänger im Wagen. In der Regel hat dieser keinen TA-Anschluß, so
daß man sich entweder durch individuelles Einlöten des Nf-Kabels
zwischen Diode und Nf-Vorröhre des betreffenden Empfängers helfen muß,
oder man nimmt als Zusatz einen kleinen Hf-Oszillator mit Pentode EF 93,
der mit der Nf-Spannung des Tonabnehmers moduliert ist. Er schwingt auf
535 kHz (oberes Ende des Mittelwellenbereiches) und speist direkt in die
Antennenbuchse des Empfängers ein, den man bei Plattenspielerbetrieb auf
diese Frequenz einstellen muß. Die Hf-Leistung ist auf 0,3 µW [!]
begrenzt. Ein Relais schaltet dann die Autoantenne ab und legt sie an
Masse, so daß jede Ausstrahlung nach außen auch über diesen Weg
vermieden wird. Die Deutsche Bundespost hat diesem Kleinstsender, dessen
Strahlung außerhalb des Kraftwagens nicht feststeilbar ist, eine vorerst
auf zwei Jahre befristete allgemeine Genehmigung erteilt.
Die Montage des „Auto-Mignons"
ist einfach. Nach Abnahme des Gehäuses läßt sich dieses unter dem
Armaturenbrett, am besten in der Wagenmitte, leicht befestigen. Das
Chassis des Plattenautomaten wird dann einfach hineingeschoben. Der
Einschub für Schallplatten wird beleuchtet, die Beleuchtungsstärke ist
in zwei Stufen (Tag/Nacht) einstellbar. Vorn trägt das Gerät zwei
Druckknöpfe. Der rechte übernimmt die Funktion einer Phonotaste am
Heimrundfunkgerät (Umschaltung von Rundfunkempfang auf Platte und
umgekehrt), und links ist der vom „Mignon" her bekannte Knopf für das
Auswerfen der zu Ende gespielten Schallplatte angebracht.
Wir möchten noch besonders auf den Registrierstreifen Bild 3 hinweisen.
Hier sind sowohl oben die auf das Mignon-Chassis auftreffenden Stöße bei
einer Versuchsfahrt aufgezeichnet als auch unten die Ausgangsspannung
des Tonabnehmers beim Abtasten einer 100-Hz-Meßplatte. Hätte man
beispielsweise eine 1000-Hz-Meßplatte aufgezeichnet, dann wären
Unregelmäßigkeiten der Ausgangsspannung überhaupt nicht oder fast nicht
aufgetreten. Hingegen nähert sich die 100-Hz-Frequenz schon etwas der
Frequenz der Erschütterungen (3...30 Hz).
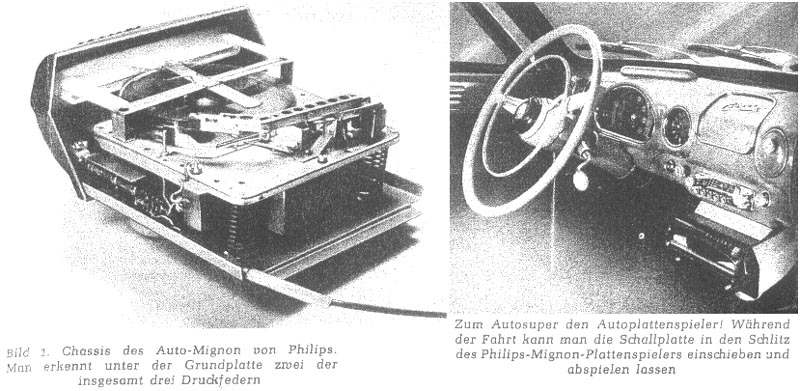
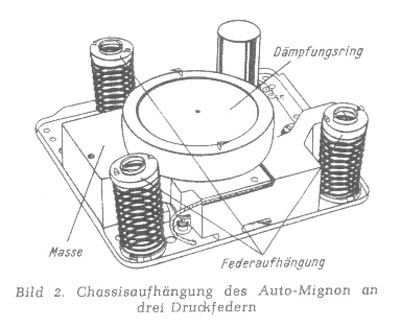
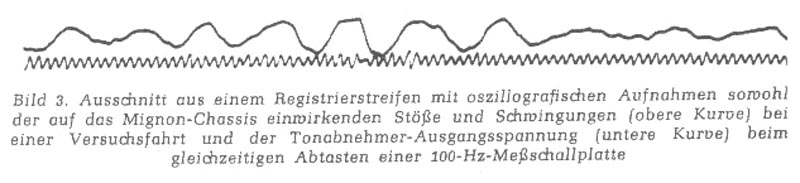
Der Schallplattenautomat „Mignon"
Quelle: Heft 21 /
FUNKSCHAU 1956 (Seite 883 - 884):
Bei aller Einfachheit der Konstruktion ist der
neue Philips - Plattenspieler „Mignon" eine bemerkenswerte technische
Leistung. Das aus Bild 1 ersichtliche Kunststoffgehäuse in beige und
dunkelrot ist bis auf den schmalen Schlitz an der Vorderseite
geschlossen. In diesen Schlitz schiebt man eine 17-cm-Kleinplatte (45
U/min) hinein, ähnlich wie man einen Brief in den Postkasten wirft, und
sofort wird die Platte abgespielt. Nach Beendigung dieses Vorganges
springt sie wieder halb aus dem Schlitz heraus, so daß man sie fassen
und herausziehen kann. Es ist somit der ideale Plattenspieler für
technisch unbegabte Phono-
freunde, für Kinder und für jene, deren Hände schon etwas zittern und die
daher für das Aufsetzen des leichten Tonarms nicht recht geeignet sind.
Die sinnvolle und sicher funktionierende Automatik wird allerdings durch
die Beschränkung auf nur eine Plattenart erkauft. Philips entschied sich
für die 17-cm-Kleinplatte mit 45 U/min, deren Anteil an der deutschen
Schallplattenproduktion auf bereits 40% gestiegen ist und deren Vorzüge
allgemein bekannt und unbestritten sind.
Bild 2 zeigt das Chassis des neuen Plattenspielers von oben. Der
Anschlagstift C ist das zentrale Steuerorgan; er wird durch die
hineingeschobene Schallplatte um 24 mm ausgelenkt. Der Stift ist mit dem
Schaltsegment L verbunden (siehe Bild 3), dessen drei Steuerarme die im
Zeitschema Bild 4 dargestellten Vorgänge auslösen. Der eine Arm betätigt
den Netzschalter N, so daß der Motor anläuft. Der zweite hebt über den
Steuerhebel P das Mittelstück K, allgemein „Bobby" genannt, auf dem
Plattenteller an und zentriert auf diese Weise die hineingeschobene
Platte. Der dritte Arm schließlich senkt über den Hubstift M das
Tonabnehmersystem B auf die Schallplatte. In diesem Augenblick geht der
Bobby K nach oben und öffnet dabei den Nf-Schalter O. Noch kurz vorher
hat der sich seiner Endstellung nähernde Anschlagstift C die horizontale
Tonarmbewegung durch Entsperren der Klinke E freigegeben. Die
Schallplatte läuft . . .
Nach dem Erreichen der Auslaufrille stößt der Mitnehmer F den Kipphebel G
an, der unter Federvorspannung steht. G wird von einer Zahnscheibe unter
dem Plattenteller zurückgestoßen. Das Schaltsegment L läuft in seine
Ausgangslage zurück und löst dabei folgende Vorgänge aus:
Der Bobby senkt sich und gleichzeitig hebt sich der Tonkopf an; durch
Senken des Bobbys wird der Nf-Schalter geschlossen.
Der Tonarm wird herausgeführt; Anschlagstift C läuft nach vorn, er schiebt
die Schallplatte aus dem Schlitz hinaus;
der Tonarm wird durch die Sperrklinke E arretiert, und zuletzt wird der
Motor abgeschaltet.
Die Bürste D wird vom Anschlagstift C beim Hinein- und Herausschieben der
Schall-
platte jeweils einmal unter dem Saphir durchgezogen und reinigt diesen.
Vorn am Gerät ist die Unterbrechertaste I angebracht; sie drückt bei
Betätigung das Schaltsegment L und damit den Anschlagstift sofort in die
Ausgangslage, so daß die vorstehend aufgezählten Funktionen ausgelöst
werden und die Platte unmittelbar vorn herausspringt.
Der zeitliche Ablauf aller Funktionen ist so genau festgelegt, daß
Fehlschaltungen eigentlich unmöglich sind. Zwischen dem Einschieben der
Platte und dem Beginn des Abspielens liegen nur Bruchteile einer
Sekunde; eine evtl. kurzfristige Verzögerung im Beginn der Wiedergabe
ist auf die manchmal dem eigentlichen Platteninhalt vorgespannten
wenigen Leerrillen zurückzuführen.
Aufmachung und „finish" des Gerätes sind vorbildlich und absolut
geschmackvoll, und auch die Unterbringung des 150 cm langen Netz- und
des 120 cm langen Verbindungskabels (zu den TA-Buchsen des Empfängers)
ist durch ein abgedecktes Kabelfach auf der Unterseite gut gelöst. Im
täglichen Gebrauch ist dieser Musikautomat sehr angenehm; man sitzt
beispielsweise behaglich am Kaffeetisch, reicht seinem Gast einen Stapel
Kleinplatten mit der Bitte um Auswahl -und schon kann man diese und jene
der herausgesuchten Schallplatten hintereinander oder mit Pause
abspielen. Die Erweiterung des Gerätes um eine längere
Anschlußverbindung zum Empfänger mit eingefügtem Lautstärkenregler würde
die Anlage vorteilhaft ergänzen.
Bei der Konstruktion mußten sich die Entwickler für die Verwendung von
17-cm-Klein-platten mit dem ursprünglichen großen Mittelloch (38 mm)
oder mit Einsatzstück entscheiden. Sie wählten den in Bild 2 erkennbaren
und im Text mehrfach erwähnten Bobby, so daß der Benutzer des Gerätes
die Einsatzstücke seiner Kleinplatte herausbrechen muß. Jetzt kann er
diese Platten nicht mehr durch einen handelsüblichen Plattenwechsler mit
dünner Mittelachse laufen lassen, sondern muß sich — soweit noch nicht
geschehen — eine dicke, auf den Wechsler aufsteckbare Achse mit
zentralem Abwurfmechanismus beschaffen, wie sie unter dem Namen
„Wechselspindel" oder „Stapelachse 38" von verschiedenen Firmen
geliefert wird. Wer jedoch den Automaten „Mignon", dessen Vorläufer für
Normalplatten mit 78 U/min wir vor mehreren Jahren einmal im Ausland
gesehen hatten, als einzigen Plattenspieler wählt, wird nicht in diese
Verlegenheit kommen.
Keine 78er-Schallplaften mehr bei Columbia
Aus den USA wird gemeldet, daß Columbia allmählich sämtliche
78er-Schallplatten aus dem Katalog streicht. Künftig werden
volkstümliche Neuerscheinungen fast nur noch auf 45er-Platten in den
Handel gebracht. Auch bei den anderen Firmen ist man geneigt, die
Normalschallplatten mit 78 U/min aufzugeben. In Deutschland wird die
Umstellung nicht so schnell erfolgen wie in Amerika oder England, weil
dann viele Schallplattenfreunde neue Laufwerke anschaffen müßten.
Plattenspieler, die nur mit 78 Umdrehungen arbeiten, sind noch recht
weit verbreitet. Die Schallplatten-Hersteller setzen sich jedoch sehr
für eine Bevorzugung der 45er-Platte ein. Der im vorhergehenden Beitrag
beschriebene neue Philips-Plattenspieler Mignon ist ein weiterer Schritt
auf diesem Wege.
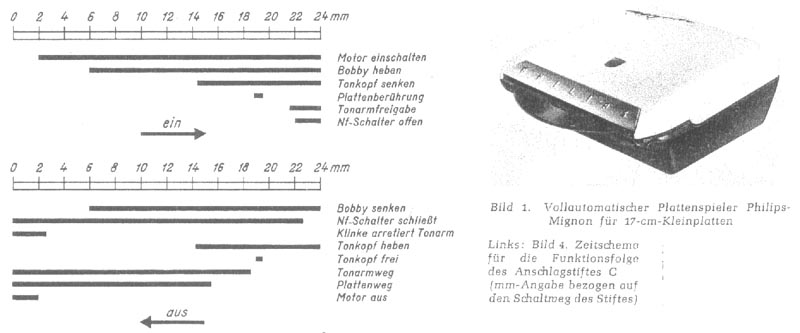
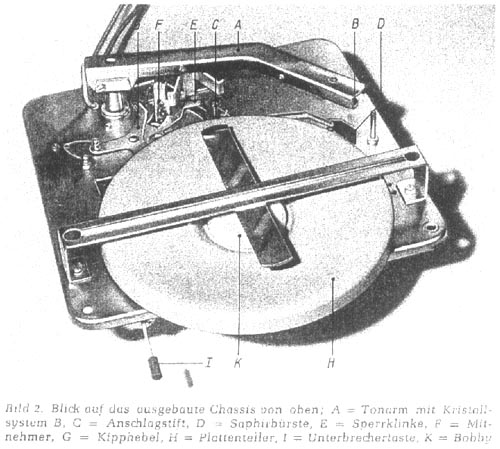
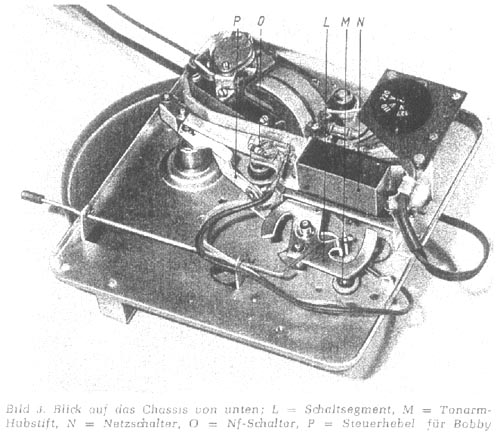 |